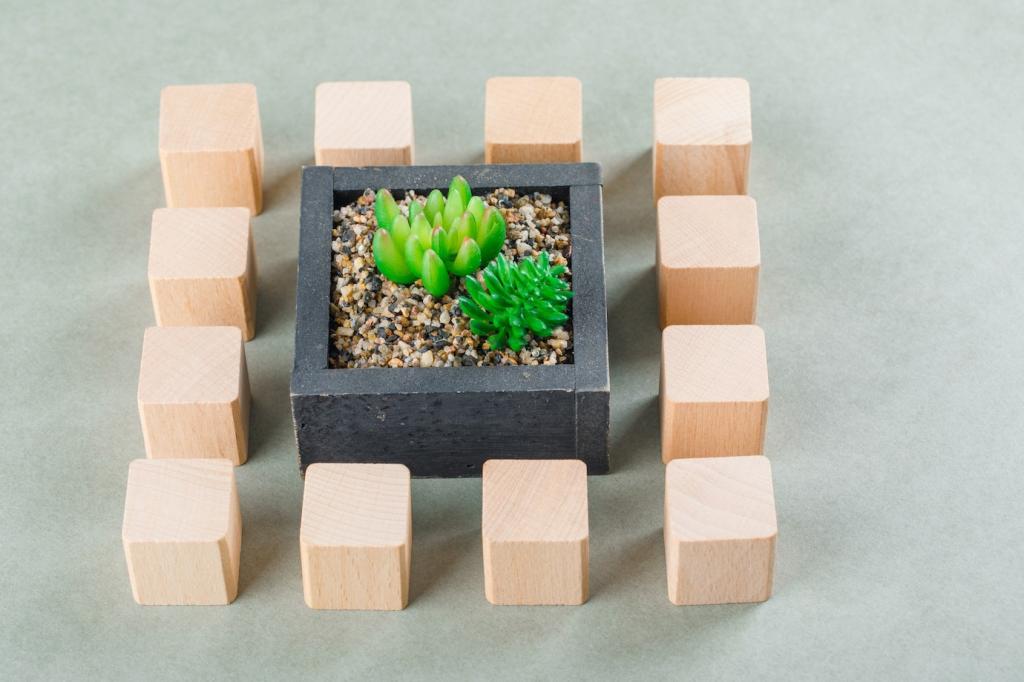Wasser unter Druck: Dürren, Fluten und Feuchtgebiete
Ausgetrocknete Moore verlieren ihre kühlende, speichernde Kraft und setzen enorme Mengen CO₂ frei. In Hitzesommern entzünden sich Torfschichten erschreckend schnell. Renaturierung und Wiedervernässung sind deshalb echte Klimaschutzmaßnahmen direkt im Naturschutzgebiet.
Wasser unter Druck: Dürren, Fluten und Feuchtgebiete
Heftige Niederschläge reißen Ufer auf, verschieben Kiesbetten und bedrohen Brutplätze bodenbrütender Vögel. Auwälder können dämpfen, wenn sie ausreichend Raum haben. Mehr Platz für Flüsse ist praktischer Hochwasserschutz und stärkt die Lebensvielfalt nachhaltig.